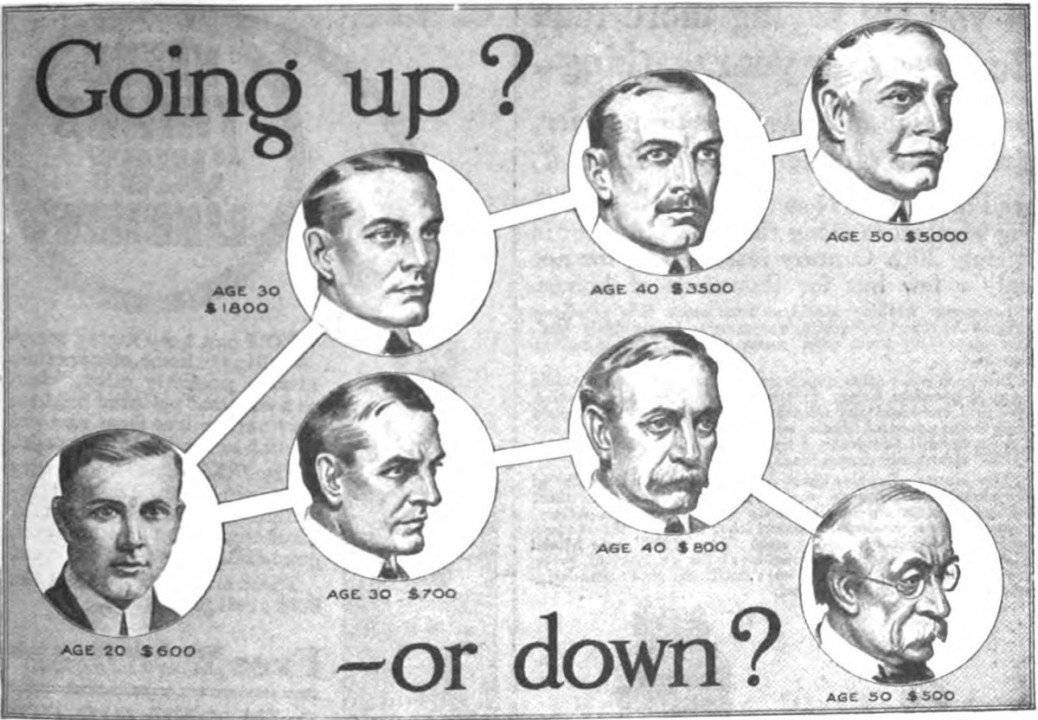Ein Blogbeitrag von Tobias Ritterskamp (HU Berlin)
Im Alter von sechs Jahren wurde ich in die Bücherwurmgrundschule in Berlin-Hellersdorf eingeschult. Von Wissbegier beseelt und voller Euphorie, am ersten wie am letzten Schultag, durchlief ich diese erste Bildungsinstanz, wenngleich der Gegenwind, der mich hier und da ins Wanken brachte, an seinem „Vorhaben“ scheiterte, ja scheitern musste, hatte er doch nicht mit meinem Widerstand gerechnet.

Werde selbst BloggerIn bei der DNGPS! Mehr Infos findet ihr hier.
Meine Resilienz zahlte sich aus, denn mir gelang der Sprung auf das Gymnasium. Doch der Weg zum Abitur war ein schwieriger, da ich die „irgendwie“ spürbaren Unterschiede unter uns Schülern sowie Hürden, die es zu überwinden galt, bewusster und reflektierter wahrnahm, als dies noch in der Grundschule der Fall gewesen ist. Wie nur die Hochschulreife erreichen, wenn man Goethes „Faust“ für einen Actionfilm mit Sylvester Stallone hält und aus der eigenen Familie niemand auch nur ansatzweise (indirekte und/oder direkte) Unterstützung bei der Bewältigung des schulischen Stoffs leisten kann?
Ich habe mein Abitur dennoch erfolgreich absolviert, und bin anschließend zum Studieren an die Humboldt-Universität zu Berlin gegangen. Obgleich ich so etwas wie Stolz und Glück empfinde darüber, wie mein bisheriger Bildungsweg verlaufen ist, muss konstatiert werden, dass Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem nach wie vor ein Mythos ist (vgl. Ditton/Maaz 2011; vgl. Allmendinger 2012; vgl. Hradil 1999; vgl. Preisendörfer 2008). Doch mit Blick auf Habitus und Kapital ist auch heute wieder, 45 Jahre nach Erscheinen des Buchs „Die Illusion der Chancengleichheit“, die Frage zu stellen, warum Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem ein Mythos ist, denn Bildung ist eine soziale Frage (vgl. Becker 2011:9). Um dies zu klären, werde ich den Terminus „Chancengleichheit“ explizieren, Basil Bernsteins Sprachcodes einerseits und andererseits Bourdieus Habituskonzept sowie seinen Kapitalbegriff heranziehen, da beides (Habitus und Kapital) im Zusammenspiel die Reproduktion sozialer Ungleichheit befördert (vgl. Cerci 2013).
Generell liege Chancengleichheit im Bildungssystem nach Stefan Hradil dann vor, „wenn der Erwerb von Bildungsgraden und die dadurch erfolgende Verteilung von Lebenschancen“ so erfolgen, „dass sie sich ausschließlich an der individuellen Leistung bemessen“ (Hradil 1999: 148). Nach dieser Definition hat also jedes Individuum unabhängig von sozialer Herkunft und anderen Merkmalen gleiche Chancen auf den Bildungserfolg.
Die Leib gewordene Geschichte
Bourdieu zufolge ist der Habitus ein „sozial konstituiertes System von strukturierten [opus operatum] und strukturierenden Dispositionen [modus operandi], das durch Praxis erworben wird und konstant auf praktische Funktionen ausgerichtet ist“ (Bourdieu/Wacquant 1996: 154). Er konstituiert sich also durch die Position des Akteurs innerhalb der Sozialstruktur (vgl. Müller 2014: 39). Neben klassenspezifischen Dispositionen zeichnet sich der Habitus im Alltag durch systematisch strukturierte Denk-, Wahrnehmungs- und Beurteilungsschemata aus (vgl. ebd.: 37f.), sodass man ihn auch als „Leib gewordene Geschichte“ bezeichnen kann (Bourdieu 1985: 69). Als System einverleibter, inkorporierter Muster und Handlungsformen, die die Reproduktion sozialer Ordnung aufrechterhalten, kann er insofern als „stabil und dauerhaft“ betrachtet werden (vgl. Rehbein/Saalmann 2009: 111f.; Müller 2014: 41).
Institutionalisiertes Kapital sichert den Inhabern eine rechtliche Garantie der erworbenen Titel
Hans-Peter Müller zufolge könne man das Habituskonzept nach Pierre Bourdieu zusammenfassend in fünf Momenten unterteilen: Der Habitus stelle einerseits einen Teil verinnerlichter Gesellschaft dar, weshalb Müller von der inkorporativen Maßnahme spricht. Außerdem werden die für das Handeln zur Verfügung stehenden Strategien unbewusst eingesetzt. Daher gilt die Annahme von Unbewusstheit. Trotz alledem handeln die Subjekte interessengeleitet, was das Vorhandensein einer Strategie impliziert. Obgleich sich der Habitus durch seine Stabilität auszeichnet, das heißt, die erworbenen Dispositionen die individuellen Handlungsstrategien trotz der sich wandelnden Umwelt anleiten (Stabilitätssuppositum), ist ein Wandel des selbigen durch neue Erfahrungen möglich (Annahme der Wandelbarkeit) (Müller 2014: 42f.).
Da sich auch die Sprache im Habitus niederschlägt, sei an dieser Stelle auf Basil Bernsteins Unterscheidung der Sprachcodes hingewiesen. Er grenzt den elaborierten vom restringierten Sprachcode ab (Bernstein 1975: 196ff.). Diese unterscheiden sich in dreierlei Hinsicht voneinander: Auf der Ebene der Lexik geht es um die zur Verfügung stehenden Wahloptionen hinsichtlich des Vokabulars. Die syntaktische Dimension fokussiert sich auf die verfügbaren syntaktischen Alternativen und beschäftigt sich mit der Satzstruktur, während die Semantik ihren Blick auf die differierende Bedeutung sprachlicher Äußerungen richtet (vgl. Sander 2007: 16; vgl. Bernstein 1970: 100ff.; vgl. Slotta 2011: 15; vgl. Pause 2002: 1).
Der restringierte Sprachcode zeichnet sich durch kurze Sätze, mangelnde Präzision, Kontextunabhängigkeit sowie dem Präsenz als Zeitform aus und verweist primär auf die Arbeiterschicht und einen geringen Bildungsgrad (vgl. Bernstein 1975: 203f.; vgl. ebd.: 19; vgl. Sertl/Leufer 2012: 10; vgl. Sadovnik 2012: 40). Unterdessen deutet der elaborierte Sprachcode auf die Mittel- und Oberschicht mit höherem Bildungsgrad hin. Neben dem größeren Vokabular und einer vornehmeren Ausdruckform ist die elaborierte Sprechweise kontextunabhängig (vgl. Sander 2007: 19; vgl. Sertl/Leufer 2012: 15).
Die Macht des institutionalisierten Kapitals
Kapital sei, so Bourdieu, „akkumulierte Arbeit, entweder in Form von Materie oder in verinnerlichter, ´inkorporierter´ Form“ (Bourdieu 1983: 183). Diesen Terminus einzig und allein auf Arbeit zu reduzieren, ist allerdings ungenügend, denn Bourdieu geht es aus soziologischer Perspektive primär um die Rolle des Kapitals als Machtfaktor in sozialen Beziehungen, sodass es konstitutiv für soziales Handeln ist (vgl. Rehbein/Saalmann 2009: 135). Er unterscheidet vier Arten von Kapital: Das ökonomische Kapital ist leicht in Geld konvertierbar und bezeichnet Eigentum und Vermögen (Bourdieu 1983: 185; vgl. Müller 2014: 48; vgl. Burzan 2003: 110). Unterdessen nimmt das kulturelle Kapital, oder einfacher ausgedrückt, das Bildungskapital, drei Formen an (ebd.: 185ff.; vgl. ebd.: 52ff.; vgl. ebd.: 110f.). Das inkorporierte Kulturkapital meint durch familiale und schulische Sozialisation vermittelte(s) Bildung und Wissen.
Es wird mit der Zeit ein fester Bestandteil der Persönlichkeit, da bestimmte Schemata internalisiert werden, sprich Dispositionen bilden, sodass durch den Prozess des Verinnerlichens aus dem ´Haben´ ein ´Sein´ geworden ist (Bourdieu 1983: 186ff.; vgl. Müller 2014: 53). Kulturelle Güter wie Bücher, Gemälde und Instrumente sind dem objektivierten Kulturkapital zuzuordnen. In deren Genuss kommt man jedoch nur dann, wenn man über das nötige inkorporierte Kulturkapital verfügt (Geigenspiel, expressionistische Malerei et cetera), wofür
Zeit und oftmals auch Geld benötigt wird (ebd.: 188f.; vgl. ebd.: 53f.). Institutionalisiertes Kapital sichert den Inhabern eine rechtliche Garantie der erworbenen Titel (Abitur, Master et cetera) zu, weshalb durch die institutionelle Anerkennung die Möglichkeit einer Übertragung in ökonomisches Kapital besteht (vgl. Burzan 2003: 111; vgl. Müller 2014: 54). Verfügt das Subjekt über ein mobilisierungsfähiges Netzwerk von Beziehungen, so besitzt es viel Sozialkapital (vgl. ebd.: 111; vgl. ebd.: 49).
Bei diesem handele es sich „um Ressourcen, die auf der Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen“ (Bourdieu 1983: 190f.). Um das von der sozialen Herkunft abhängige mobilisierungsfähige Netz aufrechtzuerhalten, bedarf es einer kontinuierlichen Beziehungsarbeit in Form zeitlicher und finanzieller Investitionen unter anderem, wenngleich der wirtschaftliche Nutzen verschleiert werden muss, um künftige freundschaftliche Dienste in Anspruch nehmen zu können (vgl. ebd.: 49). Das symbolische Kapital bezeichnet Renommee oder Prestige einer Person, die sich aus der sozialen Wahrnehmung der zuvor genannten Kapitalien ergeben, so Bourdieu (Bourdieu 1985: 11; vgl. Müller 2014: 54ff.). Dadurch, dass es soziale Anerkennung wiederspiegelt, ist es der Legitimierung gesellschaftlicher Herrschaftsverhältnisse dienlich (vgl. Burzan 2003: 112).
Bildungserfolg eine Kapitalsache
In Deutschland gilt nach wie vor, dass Bildungserfolg und soziale Herkunft im internationalen Vergleich stark aneinandergekoppelt sind (vgl. Ditton/Maaz 2011: 203; vgl. Bildungsbericht 2014: 96), sodass es nicht verwundern muss, wenn 14,6% der Kinder von Eltern ohne Bildungsabschluss ebenfalls ohne Bildungsabschluss bleiben (vgl. Solga/Dombrowski 2009: 15). Eine zentrale Rolle spielen hierbei die bereits bei der Einschulung vorhandenen Disparitäten, die auch beim Übergang auf andere Schulformen von Bedeutung sind (vgl. Ditton/Maaz 2011: 203f.). So zeige sich, dass Kindern aus den oberen Schichten bis zur Einschulung 1700 Stunden lang vorgelesen wird, während dies beim Unterschichtennachwuchs nur zu einem Bruchteil der Fall ist (30 Stunden), was sich in Wortschatz (etwa 1100 Wörter zu circa 550 Wörter) und IQ (117 zu 79) deutlich wiederpiegelt (vgl. Preisendörfer 2008: 65f.).
Die Chance, ein Gymnasium zu besuchen, ist für Jugendliche aus den oberen Schichten weitaus höher (84%) als für diejenigen aus der Arbeiterschicht (33%)
Häufiges Vorlesen kann daher zur Förderung der sprachlichen Fähigkeit des Kindes beitragen (vgl. Bildungsbericht 2014: 47). Ein zum Zeitpunkt des Schuleintritts bereits vorhandener, in den Worten Basil Bernsteins, adäquater Sprachcode ist daher für eine aktive Mitarbeit sowie das Textverständnis sicherlich hilfreich und dürfte einer von zahlreichen Schritten in Richtung Chancengleichheit im Bildungssystem sein. Jedoch spricht das von Preisendörfer geschilderte Ergebnis aufgrund des schichtspezifischen Wortschatzes eher für das Gegenteil. Heike Solga und Rosine Dombrowski konstatieren, dass soziale Schicht, Bildungsgrad der Eltern sowie die Anzahl der Bücher im Haushalt zu 17,9% die unterschiedliche Lesekompetenz von Viertklässlern verschiedener Schichtzugehörigkeit erklären, weshalb die Weitergabe familiären kulturellen Kapitals in beinahe all seinen Formen an den Nachwuchs für die weitere Bildungslaufbahn von großer Bedeutung ist (vgl. Solga/Dombrowski 2009: 13f.). Während die Gymnasialempfehlung für Kinder aus Akademikerfamilien der Regelfall sei und sie eine trotz identischer kognitiver Fähigkeiten et cetera wie Kinder aus anderen sozialen Schichten eine um das 2,64-fache höhere Wahrscheinlichkeit haben, das Gymnasium zu besuchen (vgl. Allmendinger 2012: 80), so stelle dies bei bildungsfernen- respektive Unterschichtenkindern eher eine Ausnahme dar, müssten sie doch erst mal ihr Talent unter Beweis stellen (vgl. Preisendörfer 2008: 58).
Im Bundesdurchschnitt zeige sich gar, dass die Chance, auf das Gymnasium zu kommen bei den Kindern aus wohlhabenderen Haushalten um das 4,5-Fache über der Chance von Kindern aus den unteren Schichten liegt (vgl. Allmendinger 2012: 80). Es ist daher wenig überraschend, dass Bildungschancen immer noch von sozialer Herkunft abhängen (vgl. Becker 2011: 101). Vorstellbar ist, dass der schichtspezifische Habitus der Kinder aus sozial schwachen Familien mit den Erwartungen der mittelschichtsorientierten Schulen unvereinbar erscheint, da letztere auf sozioökonomische und kulturelle Differenzen nur unzureichend vorbereitet sind (vgl. Schroeder 2007: 78), was sich in den Lesekompetenzen oder im Sprachverhalten wiederspiegeln könnte. Würde es sich in der Grundschule um eine neutrale Benotung handeln, so könnte man den Einfluss der sozialen Herkunft auf die Leistungen der Schüler um 50% reduzieren (vgl. Allmendinger 2012: 82).
Gewöhnung defizitärer Sozialisation
Die IGLU-Studie von 2003 sowie die Untersuchung zur Lernausgangslage der Lernentwicklung (LAU) zwischen 1996 und 2005 kommen zu dem Ergebnis, dass Übergangsempfehlungen nur selten etwas mit den Fähigkeiten zu tun hätten (vgl. Preisendörfer 2008: 58). Insofern scheint es laut Bildungsbericht von 2003 nicht verwunderlich, wenn die Chance, ein Gymnasium zu besuchen, für Jugendliche aus den oberen Schichten weitaus höher ist (84%) als für diejenigen aus der Arbeiterschicht (33%) (vgl. ebd.: 59f.). Von ersteren nehmen später 72% ein Studium auf, derweil von letzteren nur 33% an die Universität gehen (vgl. Kluge 2003: 72f.). Des Weiteren konstatiert der Bildungsbericht von 2014, dass Kinder der 5. Klasse aus Familien mit hohem sozioökonomischen Status weitaus häufiger das Gymnasium besuchen (64%) als jene mit niedrigem (21%) und auch beim Besuch der Hochschule sowie den sozialen Unterschieden weiterhin ein enger Zusammenhang besteht (vgl. Bildungsbericht 2014: 6, 75 und 294).
An dieser Stelle darf sich durchaus gefragt werden, ob die Reproduktion von Chancenungleichheit nicht die eigentliche Aufgabe des Bildungssystems ist, kommt doch die Politik der sozialen Selektion genau jenen zugute, die von ihr profitieren (vgl. Preisendörfer 2008: 61). Vielleicht ist es an der Zeit, sich vom meritokratischen Prinzip, sprich dem Postulat einer Chancengleichheit, unabhängig von sozialer Herkunft et cetera, endlich zu verabschieden, denn die Forderung nach Bildungsegalität ist absurd, da die ungleiche Verteilung sozioökonomischer Ressourcen höchstens das Streben nach einer Minimierung der sozialen Ungleichheit von Bildungschancen erlaube (vgl. Becker 2011: 90). Die Startvoraussetzungen sind also nach wie vor ungleich und in Deutschland zeigt sich noch immer, dass die sozioökonomischen Ungleichheiten stärker auf die individuellen Bildungschancen wirken als dies die Bildungsinstitutionen mit ihrer Kompensationsfunktion tun (vgl. ebd.: 90f.).
Während die einen privilegiert sind, gewöhnen sich die Kinder der Unterschichtenfamilien infolge defizitärer Sozialisation „an das schmutzige Erbe geistigen Mangels“, was unter anderem zu eingeschränkten Sprach- und Denkfähigkeiten sowie begrenztem Kunstverständnis führt (Preisendörfer 2008: 65). Der Habitus hat also einen Einfluss auf den Bildungserfolg, führe er nach Bourdieu schließlich dazu, dass erstrebenswert ist, „wozu [die Menschen] ohnehin verdammt sind“ (Bourdieu 1993, 1999 zitiert nach Allmendinger 2012: 92). Auch die ungleiche Verteilung von Kapital wirkt sich sicherlich auf die Ungleichheit im Bildungssystem aus, denn der Mangel an diesem, hier vor allem des inkorporierten kulturellen Kapitals in den unteren Schichten, könnte für die mittelschichtsorientierten Schulen vermutlich ein inakzeptables Defizit an Bildung und Wissen darstellen, da sich an den Bildungsstandard der Mittelschicht orientiert wird (vgl. Schroeder 2007: 78). Rolf-Torsten Kramer und andere weisen darauf hin, dass Kinder bereits frühzeitig einen Habitus entwickeln, sodass sie sich beizeiten auf die für sie relevanten Schulformen konzentrieren (vgl. Allmendinger 2012: 92f.).
Warum ist Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem ein Mythos?
Chancengleichheit im deutschen Bildungssystem ist ein Mythos, denn die soziale Herkunft entscheidet nach wie vor über die Bildungschancen von Kindern, haben doch Kinder aus den wohlhabenderen Elternhäusern weitaus größere Chancen, das Gymnasium zu besuchen als jene aus ärmeren Familien. Deshalb spielt auch der Habitus eine gewichtige Rolle, da dieser sich je nach Schicht unterscheidet (vgl. Rehbein/Saalmann 2009: 115). Auch das Kapital, das im Zusammenspiel mit dem Habitus einen Einfluss auf die soziale Ungleichheit der Bildungschancen hat, wirkt sich auf letztere aufgrund der Mittelschichtsorientierung der Schulen aus, da die Bildungsinstitutionen auf die sozioökonomischen und kulturellen Differenzen nur mangelhaft vorbereitet sind, sodass Kinder mit zum Zeitpunkt des Schuleintritts schlechten Sprachfähigkeiten vermutlich Probleme haben werden, den Lehrinhalten zu folgen. Der Erwerb von Bildungszertifikaten bemisst sich also immer noch nicht auf individuelle Leistung, wie es nach Stefan Hradils Definition von „Chancengleichheit“ sein sollte. Natürlich wurzeln die Ursachen von Bildungsungleichheit nicht nur im Mangel an Kapital und schlechter habitueller Prägung, da auch zahlreiche andere Aspekte eine Rolle spielen (vgl. Allmendinger 2012: 175ff.). Beispielsweise gibt es keine „nationale Bildungsstrategie“ (ebd.: 227), aber wenn es sie erst mal gibt, ist vielleicht wenigstens eine Reduktion der Ungleichheit von Bildungschancen möglich.
Literaturverzeichnis
- Allmendinger, Jutta (2012): Schulaufgaben. Wie wir das Bildungssystem verändern müssen, um unseren Kindern gerecht zu werden. München: Pantheon.
- Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hrsg.) (2014): Bildung in Deutschland 2014. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zur Bildung von Menschen mit Behinderun-gen. Bielefeld: Bertelsmann.
- Becker, Rolf (2011): Bildungssoziologie – Was sie ist, was sie will, was sie kann. In: Rolf Becker (Hrsg.). Lehrbuch der Bildungssoziologie. 2. Überarbeitete und erweiterte Aufl., Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, S. 9-36.
- Bernstein, Basil (1970): Elaborierte und restringierte Codes. In: Soziale Struktur, Sozialisation und Sprachverhalten. Aufsätze 1958-1970. Amsterdam: De Munter, S. 99-116.
- Bernstein, Basil (Hrsg.) (1975): Sprachliche Kodes und soziale Kontrolle. (Orig. Class, Codes and Control II., 1973. Aus dem Englischen v. J. Donath und W. Mock. Düsseldorf: Pädagogi-scher Verlag Schwann.
- Bourdieu, Pierre (1983): Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. In: Rein-hard Kreckel (Hrsg.): Soziale Ungleichheiten (Soziale Welt Sonderband 2). Göttingen: Otto Schwartz & Co, S. 183-198.
- Bourdieu, Pierre (1985): Sozialer Raum und Klassen Leçon sur la leçon. Zwei Vorlesungen. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
- Bourdieu, Pierre (1993): Sozialer Sinn. Kritik der theoretischen Vernunft. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
- Bourdieu, Pierre/Wacquant, Loïc J. D. (1996): Reflexive Anthropologie. Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag.
- Burzan, Nicole (2003): Soziale Ungleichheit. Ein Überblick über ältere und neuere Ansätze. Fernuniversität: Hagen.
- Cerci, Meral (2013): Reproduktion sozialer Ungleichheit und Habitus. Düsseldorf: Heinrich- Heine-Universität. In: https://www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/fileadmin/Redaktion/Institute/Sozialwissenschaften/BF/Lehre/SoSe2013/Bildung__Migration__Milieu/Act_Different_Meral_Cerci_11_06_2013.pdf (letzter Zugriff: 04.01.2016).
- Ditton, Hartmut/Maaz, Kai (2011): Sozioökonomischer Status und soziale Ungleichheit. In: Heinz Reinders/Hartmut Ditton/Cornelia Gräsel/Burkhard Gniewosz (Hrsg.). Empirische Bil-dungsforschung. Gegenstandsbereiche. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hradil, Stefan (1999): Soziale Ungleichheit in Deutschland, 7. Aufl., Opladen: Leske + Budrich.
- Kluge, Jürgen (2003): Schluss mit der Bildungsmisere. Ein Sanierungskonzept. Frankfurt am Main/New York: Campus.
- Müller, Hans-Peter (2014): Pierre Bourdieu. Eine systematische Einführung. Berlin: Suhrkamp Verlag.
- Pause, Peter E. (2002): Einführung in die Semantik. Konstanz: Universität Konstanz.
- Preisendörfer, Bruno (2008): Das Bildungsprivileg. Warum Chancengleichheit unerwünscht ist. Frankfurt am Main: Eichborn AG.
- Rehbein, Boike/Saalmann, Gernot (2009): Habitus (habitus). In: Gerhard Fröhlich/Boike Reh-bein (Hrsg.). Bourdieu Handbuch. Leben – Werk – Wirkung. Stuttgart/Weimar: J. B. Metzler, S. 110-118.
- Sadovnik, Alan R. (2012): Theorie und Forschung in der Erziehungs- und Bildungssoziologie – einige Vorbemerkungen. In: Ullrich Bauer/Uwe H. Bittlingmayer/Albert Scherr (Hrsg.): Handbuch Bildungs- und Erziehungssoziologie. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaf-ten, S. 27-58.
- Sander, Elisabeth (2007): Entwicklungspsychologie für Lehrer. Die Entwicklung der Sprache. In: http://www.uni-koblenz.de/~psy/sander/Entwicklungspsycho/07_Praesentation (letzter Zugriff: 04.01.2016).
- Schroeder, Joachim/Ellinger, Stephan/Koch, Katja (2007): Risikokinder in der Ganztagsschu-le: Ein Praxishandbuch. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer.
- Sertl, Michael/Leufer, Nikola (2012): Bernsteins Theorie der pädagogischen Codes und des pädagogischen Diskurses. Eine Zusammenschau. In: Uwe Gellerst/Michael Sertl (Hrsg.): Zur Soziologie des Unterrichts. Weinheim: Beltz Juventa, S. 15-62.
- Slotta, Frank (2011): Einführung in die Sprachwissenschaft des Deutschen. Sprachwissen-schaft aus den Punkt gebracht. Ein Skript. Köln: Institut für deutsche Sprache und Literatur I (Universität zu Köln).
- Solga, Heike/Dombrowski, Rosine (2009): Soziale Ungleichheiten in schulischer und außer-schulischer Bildung. Stand der Forschung und Forschungsbedarf. Arbeitspapier der Hans-Böckler-Stiftung 171. Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung.